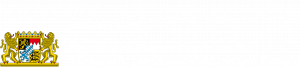Gesetz für die kommunale Wärmeplanung – Was bedeutet das für meine Heizung?
Um was geht es bei dem Gesetz?
Am 1. Januar 2024 ist das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) in Kraft getreten. Aktuell wird die landesrechtliche Umsetzung für Bayern erarbeitet.
Hintergrund des Gesetzes ist das Ziel, die Wärmeversorgung in Deutschland zu dekarbonisieren, also den CO2-Ausstoß erheblich zu reduzieren, um die Klimaziele erreichen und dem fortschreitenden Klimawandel etwas entgegensetzen zu können.
Über die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf den Wärmesektor, bei dem weiterhin überwiegend fossile Energieträger zum Einsatz kommen: Derzeit werden rund 80 Prozent des Wärmeverbrauchs durch fossile Brennstoffe wie Gas und Öl gedeckt.
Mit dem Gesetz wurden die Grundlagen für eine verbindliche und flächendeckende Wärmeplanung auf Ebene der Kommunen geschaffen. Die lokale Wärmeplanung soll helfen, den kosteneffizientesten und praktikabelsten Weg zu einer klimafreundlichen und langfristigen Wärmeversorgung vor Ort zu ermitteln. Das Ziel: bis zum Jahr 2045 unabhängig von den hauptsächlich aus dem Ausland bezogenen fossilen Energieträgern Gas und Öl und deren Preisschwankungen zu werden.
Was ändert sich für Bürgerinnen und Bürger?
Allein durch die Kommunale Wärmeplanung ergeben sich keine Änderungen für die Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunale Wärmeplanung ist lediglich ein strategisches Planungsinstrument, das Hinweise liefert, mit welcher Wärmeversorgungsoption die Gebäude zukünftig klimaneutral versorgt werden können. So soll Planungssicherheit geschaffen werden. Davon können sowohl die Kommunen als auch die Hausbesitzer und Unternehmen profitieren. Dies zeigen auch Erfahrungen aus unseren Nachbarländern, z.B. in Dänemark, wo die Kommunale Wärmeplanung ein seit Jahrzehnten etabliertes Instrument zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung darstellt.
Eine Hausbesitzerin oder ein Hausbesitzer kann beispielsweise auf die Installation einer Wärmepumpe oder einer Biomasseheizung verzichten, wenn sich als Folge der Kommunalen Wärmeplanung ergibt, dass das Gebiet, in dem sich das Haus befindet, zeitnahe an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird.
Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei der Wärmeplanung um einen langfristigen Prozess handelt, dessen Detailschärfe sich erst nach und nach entwickeln muss. Bis zu einer grundstücksscharfen Aussagekraft einzelner Wärmepläne wird es noch dauern. Das bedeutet, dass auch Eigentümerinnen und Eigentümer sich diesbezüglich noch gedulden müssen.
Konkrete Verpflichtungen für Bürgerinnen und Bürger ergeben sich erst durch die Verbindung des Gesetzes zur kommunalen Wärmeplanung mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Welche Auflagen gibt es bei einem Heizungstausch?
Mit Ablauf des Jahres 2044 ist es endgültig verboten, Heizkessel mit fossilen Brennstoffen zu betreiben (vgl. § 72 Abs. 4 GEG). Fossile Heizungen müssen spätestens bis zu diesem Stichtag entweder ausgetauscht oder mit 100% klimaneutralen Brennstoffen betrieben werden.
Momentan können Eigentümer von Bestandsgebäuden grundsätzlich weiterhin frei darüber entscheiden, welche Heizung sie im Falle eines Austauschs neu einbauen, allerdings nur bis zum formellen Beschluss über die Ausweisung von Wärmeversorgungsgebieten im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung in ihrer jeweiligen Kommune[1].
Allerdings ist hierbei Vorsicht geboten: Heizungen, die mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff beschickt und vor der Fertigstellung der Kommunalen Wärmeplanung bzw. dem Ablauf der entsprechenden Frist installiert werden, müssen ab 2029 mit einem stetig steigenden Anteil an Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff betrieben werden (zunächst 15 Prozent, ab 2035: 30 Prozent, ab 2040: 60 Prozent, vgl. § 71 Abs. 9 GEG). Hierfür ist die Heizungsbetreiberin bzw. der Heizungsbetreiber selbst verantwortlich. Es lohnt sich also im Falle des Heizungstauschs, gleich auf eine erneuerbare Wärmeversorgungsvariante zu setzen, bzw. im Vorfeld zu klären, ob und wie die gesetzlichen Anforderungen von der Heizungsanlage eingehalten werden können.
Mit Fertigstellung der Kommunalen Wärmeplanung in der Kommune und einem offiziellen Beschluss zu zukünftigen Wärmeversorgungsgebieten bzw. spätestens mit dem Ablauf der Frist für die Fertigstellung der Kommunalen Wärmeplanung (also ab 30. Juni 2026 bzw. 2028) greift schließlich die 65 %-Regel aus dem Gebäudeenergiegesetz. In Bestandsgebäude dürfen ab diesem Stichtag nur noch Heizungsvarianten eingebaut und betrieben werden, die mindestens zu 65 % auf erneuerbaren Energien basieren. Für spezielle Heizungsvarianten sowie bei der perspektivischen Aussicht auf einen Anschluss an ein Wärme- oder Wasserstoffnetz gelten jedoch umfangreiche Übergangsfristen (vgl. § 71j, 71k GEG).
Gut zu wissen: Für ältere Heizkessel gibt es bereits bestehende Austauschpflichten:
Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, dürfen nicht mehr betrieben werden und müssen daher grundsätzlich ausgetauscht werden (vgl. § 72 Abs. 1 GEG). Jüngere Heizungen (Einbau oder Aufstellung nach dem 1. Januar 1991) dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden (vgl. § 72 Abs. 2 GEG). Ausnahmen bestehen etwa für Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel, Anlagen mit einer geringen Nennleistung oder Hybridheizungen (vgl. § 72 Abs. 3 GEG).
Welche Unterstützung bietet KLIMA³ an?
Sich über die Zukunft seiner Heizungsanlage Gedanken zu machen und zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die eigene Heizungsanlage (langfristig) auf erneuerbare Energieträger umzustellen, ist einerseits natürlich im Interesse des Klimaschutzes sinnvoll, mit Inkrafttreten der entsprechenden Gesetze aber quasi unausweichlich. KLIMA³ unterstützt Sie bei Ihren Überlegungen und Entscheidungen mit einem umfangreichen Energieberatungsangebot. Kontaktieren Sie uns gerne!
Zudem bieten wir umfangreiche Unterstützungsangebote für Kommunen in der KLIMA³-Region: Vom Vergabeprozess, über die Erstellung der Konzepte bis hin zur Maßnahmenumsetzung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Bereich „Wärmewendestrategie der Kommunen“ (https://klimahochdrei.bayern/kommunen).
[Quellen: https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/, https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/faqs/Webs/BMWSB/DE/kwp/kwp-liste.html]
[1] Deadline für diesen Beschluss ist für große Kommunen > 100.000 Einwohner der 30. Juni 2026 und für kleine Kommunen < 100.000 Einwohner der 30.Juni 2028.