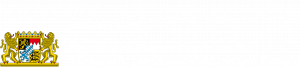Warum brauchen wir Windkraft in der Region?
Bislang gibt es in den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech 15 Windkraftanlagen an den Standorten Mammendorf, Berg und Fuchstal/Denklingen. Mit dem 2023 in Kraft getretenen Wind-an-Land-Gesetz und der Lockerung der bayerischen 10H-Regelung hat die Zahl der Genehmigungen auch in Bayern wieder zugenommen.
Die 10H-Regelung regelt den Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Siedlungen. Der Abstand berechnet sich aus der 10-fachen Höhe der Windenergieanlage (Gesamthöhe). Im November 2022 wurde die 10H-Regel gelockert. Seitdem wird beispielsweise in Wäldern, nahe Gewerbegebieten, an Autobahnen, Bahntrassen und Wind-Vorranggebieten der Mindestabstand der Windräder zur Wohnbebauung auf 1000 Meter reduziert. In Wind-Vorranggebieten wird seit Mitte 2023 sogar weiter verringert auf rund 800 Meter gemäß der Vorgabe des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).
Kontrovers diskutiert wird die Frage, wie viele Windkraftanlagen jeder Landkreis benötigt. Es gibt eine Vielzahl von Rechenmodellen und Gutachten mit stark variierenden Zahlen und Ergebnissen. Wichtig ist zu verstehen, dass die jeweils zugrundeliegenden Annahmen und Prämissen bei diesen Rechenmodellen eine starke Auswirkung auf das Ergebnis haben. Außerdem bestehen extreme Abhängigkeiten: Wieviel Strom (und damit wie viele Windenergieanlagen) im Landkreis benötigt werden, hängt beispielsweise ab von der Wärmebereitstellung, vom Individualverkehr, von der industriellen Struktur und Entwicklung. Darüber hinaus spielen die Nutzung von Wasserstoff und die angenommene Entwicklung der Energieeinsparung und des Strompreises eine wichtige Rolle. „Bierdeckelrechnungen“ werden der Komplexität in der Regel nicht gerecht.
Am Beispiel der im Landkreis Fürstenfeldbruck kursierenden Zahl von 77 Windrädern wird das Dilemma deutlich. Es wurden Annahmen getroffen wie eine Vollelektrifizierung von Mobilität und Heizwärme sowie das Ziel, den im Landkreis benötigten Strom vollständig selbst zu erzeugen. Dieses Szenario wird in einem europäischen Energiesystem so nicht eintreten. Andererseits ist zu bedenken, dass Strom, der nicht vor Ort produziert wird, an einem anderen Ort erzeugt und dann transportiert werden muss.
Das Ziel sollte also sein, soviel Energie wie möglich vor Ort bereitzustellen und gleichzeitig die Chancen des europäischen Verbundsystems hinsichtlich Verfügbarkeit, Versorgungssicherheit und Effizienz zu nutzen.