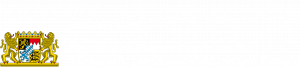Wie können wir von der Windkraft profitieren?
Gemeinden
Die Gemeinden können über verschiedene Wege finanziell von Windrädern profitieren:
- über den §6 des EEG 2023 ( 6 EEG 2023 – Einzelnorm). Dieser besagt, dass die Gemeinden in einem Umkreis von 2,5 Kilometern um das Windrad anteilig 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde (kWh) erhalten dürfen. Bei einer durchschnittlichen Strommenge von z. B. 14 Megawattstunden (MWh) im Jahr, die eine moderne Windenergieanlage produziert, sind das 28.000 Euro pro Jahr. Dieser Betrag ist von der Kreisumlage befreit und steht der Gemeinde frei zur Verfügung. Sie kann dieses Geld also sowohl für die Finanzierung eines Feuerwehrautos verwenden als auch für das Gehalt von Erzieherinnen im Kindergarten.
- über die Gewerbesteuer (Steuern und Finanzen | Energie-Atlas Bayern). Hier ist über eine Zerlegung der Gewerbesteuer seit 2021 vor allem die installierte Leistung ausschlaggebend und nicht mehr nur der Sitz des gewerbesteuerpflichtigen Unternehmens.
- über Pachtzahlungen: Gehört der Gemeinde der Grund, auf dem die Windräder stehen, vereinbart sie Pachtzahlungen mit der Betreibergesellschaft. Gibt es viele Flächeneigentümer in einem möglichen Standortgebiet, wird oft ein Flächenpooling vereinbart. So kommt die Pachtzahlung nicht nur einem einzelnen, sondern allen Eigentümern zugute.
- über eine direkte Beteiligung der Gemeinde an der Betreibergesellschaft. Dann erhält die Gemeinde Rendite wie alle anderen Investoren.
- über die regionale Wertschöpfung, etwa durch die Beauftragung von Unternehmen vor Ort bei Bau und Betrieb oder auch durch die Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung, wenn sich diese etwa direkt beteiligt.
Bürgerbeteiligung
Auch für Bürgerinnen und Bürger gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie direkt von Windenergieanlagen vor Ort profitieren können.
Oft hängt dies von der Rechtsform der beteiligten Unternehmen ab. Eine Rechtsform, die verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung bietet, ist die Kommanditgesellschaft (kurz KG). Hier können sich mehrere natürliche oder juristische Personen beteiligen, zum Beispiel eine oder mehrere Gemeinden, Stadtwerke, projektierende Unternehmen und auch viele private Kommanditisten.
Auch eine Bürgerenergiegenossenschaft kann Kommanditistin werden und dadurch ihre Mitglieder beteiligen. Das kann wiederum über Eigenkapital der Genossenschaft oder über Nachrangdarlehen der Mitglieder dargestellt werden.
Eine Bürgerenergiegenossenschaft kann aber auch als Betreibergesellschaft auftreten. Auch dann werden in der Regel die Mitglieder über Nachrangdarlehen ein Projekt mitfinanzieren.
Wo liegen die Unterschiede?
Als Kommanditist ist man Miteigentümer an einem Unternehmen und profitiert, solange die Anlage arbeitet, vom Stromverkauf. Da der Verwaltungsaufwand recht hoch ist, liegen die Mindestbeträge meist bei 5.000 bis 10.000 Euro.
Als Geber von Nachrangdarlehen gibt man ein Darlehen, das über die Laufzeit zurückgezahlt wird. Meistens ist dabei die Laufzeit des Darlehens genauso lang wie die geplante Laufzeit des Projektes. Ein Ziel vieler Bürgerenergiegenossenschaften ist es, möglichst vielen Menschen die finanzielle Beteiligung an der Energiewende zu ermöglichen. Deswegen liegen die Mitgliedsbeiträge oft zwischen 100 Euro und 1.000 Euro. Auch die Nachrangdarlehen sind oft niedrigschwellig strukturiert und fangen schon bei 1.000 Euro an.